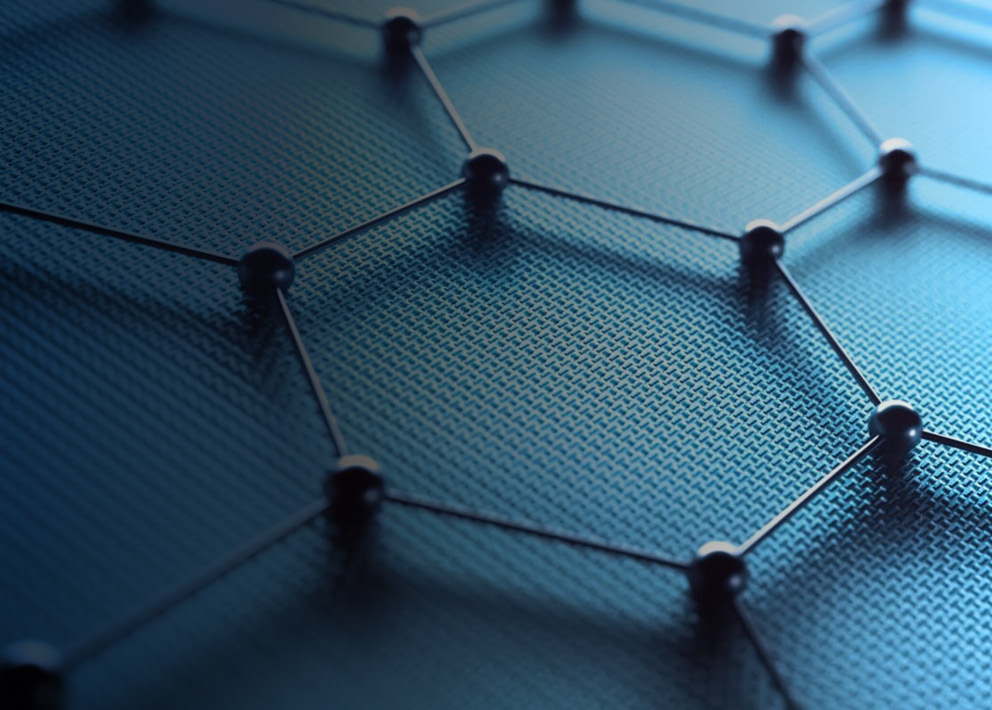- Home
- News & Insights
- Insights
- EU-Parlament beschli…
- Auf dieser Seite
5. Juli 2022
EU-Parlament beschließt Digital Services Act: Die ersten Fragen und Antworten
- Briefing
Der Digital Services Act (DSA) wurde heute (5. Juli 2022) vom Europäischen Parlament verabschiedet. Es ist eines der Leuchtturmprojekte der EU für die digitale Welt – auch bezeichnet als Grundgesetz für das Internet. Was regelt die Verordnung? Wann tritt sie in Kraft? Welche Auswirkungen hat sie auf Tech-Konzerne und Startups? Die Rechtsanwälte Philipp Koehler (Salary Partner) und Dr. Gregor Schmid (Partner) der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing geben die ersten Antworten.
Der Digital Services Act (DSA) – europaweite Spielregeln für digitale Vermittlungsdienste
Das Gesetzgebungsverfahren des DSA, einem Leuchtturmprojekt der amtierenden Europäischen Kommission zur Förderung des digitalen EU-Binnenmarktes, nähert sich dem Abschluss. Die finale Fassung wurde heute vom Europäischen Parlament abgesegnet.
Mit dem DSA unternimmt der europäische Gesetzgeber den Versuch, erstmals eine einheitliche europäische Antwort auf den Umgang mit illegalen Inhalten, Desinformationen und anderen als Risiko angesehenen Entwicklungen neuer, innovativer digitaler Geschäftsmodelle zu geben.
Anbieter digitaler Vermittlungsdienste (Intermediäre), wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Online-Marktplätze, aber auch Online-Suchmaschinen, sollen künftig nicht mehr mit unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Regelungen konfrontiert werden. Stattdessen legt der DSA einen weitgehend EU-einheitlichen Standard fest, unter welchen Bedingungen sie ihre digitalen Dienste in der EU anbieten können. Auch Nutzer und Verbraucher sollen durch die neuen EU-einheitlichen Regeln geschützt werden.
Zudem sieht der DSA die Möglichkeit der Behörden vor, erhebliche Bußgelder von bis zu 6 % des jährlichen Umsatzes zu verhängen. Als Verordnung wird der DSA unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten gelten. Die meisten Regeln des DSA gelten voraussichtlich ab dem 1. Januar 2024. Regeln für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen (mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern innerhalb der EU) können bereits früher zur Anwendung kommen, nämlich vier Monate nachdem die Europäische Kommission die jeweilige Online-Plattform bzw. Online-Suchmaschine entsprechend als solche qualifiziert hat.
Was ist das Ziel des DSA und welche Auswirkungen hat der DSA auf bestehende mitgliedstaatliche Gesetze, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)?
Philipp Koehler: „Der DSA soll nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers EU-einheitliche Spielregeln für digitale Intermediäre, zum Beispiel soziale Netzwerke und Online-Marktplätze, schaffen. Nationalen Alleingängen, wie zum Beispiel das NetzDG in Deutschland, soll damit ein Riegel vorgeschoben werden. Dies hat einerseits Erleichterungspotenzial für Unternehmen im EU-weiten Umgang mit illegalen Inhalten sowie Sorgfalts-, Transparenz- und Berichtspflichten. Andererseits erwartet der europäische Gesetzgeber einen Zuwachs an Rechtssicherheit.“
Stärkung des digitalen EU-Binnenmarktes, der Innovation und des Verbraucherschutzes
Die EU-einheitlichen Regelungen des DSA sollen den freien, grenzüberschreitenden Wettbewerb der Digitalwirtschaft im EU-Binnenmarkt fördern und eine Grundlage für Innovationen und Interoperabilität schaffen, bringen zugleich aber erhebliche neue Anforderungen mit sich. Gleichzeitig sollen der Verbraucherschutz und die europäischen Grundrechte gestärkt werden.
Hierzu sieht der DSA ein gestuftes Regulierungssystem vor, welches den Umfang der geltenden Pflichten von der Art und Einordnung des Diensteanbieters (zum Beispiel Host-Provider, Online-Plattform oder sehr große Online-Plattform) abhängig macht. Die umfangreichsten und zugleich strengsten Pflichten gelten dabei für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern innerhalb der EU. Der DSA enthält zahlreiche neue Sorgfalts-, Transparenz- und Berichtspflichten für Diensteanbieter.
Kernaspekte des DSA sind unter anderem:
- Pflicht zum schnellen und effizienten Entfernen illegaler Inhalte.
- Haftungsprivilegierungen.
- Mechanismen und formale Vorgaben für das Melden illegaler Inhalte und Nutzerbeschwerden, einschließlich der Bereitstellung eines internen Beschwerdemanagementsystems.
- Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen.
- B2C-Online-Marktplätze müssen unter anderem Daten der Händler erfassen und überprüfen (KYBC) und Maßnahmen zur Verhinderung von illegalen Inhalten ergreifen.
- Verbot von „Dark Patterns“ und Vorgaben zu „Compliance by Design“.
- Verbot personalisierter Werbung gegenüber Minderjährigen.
- Pflichten für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen in Krisenfällen (Krieg, Epidemien etc.).
- Diensteanbieter aus Ländern ohne EU-Niederlassung müssen einen Ansprechpartner in der EU benennen.
- Möglichkeit der Nutzer, Entschädigungsansprüche geltend zu machen.
Um kleinere Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz nicht unverhältnismäßig zu belasten, enthält der DSA ebenfalls einige Ausnahmen für diese, beispielsweise bei den Berichtspflichten.
Auf was müssen sich Anbieter digitaler Vermittlungsdienste insbesondere einstellen?
Dr. Gregor Schmid und Philipp Koehler: „Der DSA definiert die Spielregeln für den digitalen Binnenmarkt teilweise neu. Es ist offensichtlich, dass der DSA in vielerlei Hinsicht erheblichen Anpassungsbedarf und Aufwände auf Seiten der Diensteanbieter auslösen dürfte. So zum Beispiel bei der Ausgestaltung und beim Verfahren nachteiliger Entscheidungen gegenüber Nutzern, bei den regelmäßigen Berichten über ergangene Anordnungen, Meldungen und deren Abwicklung, beim Design von Angeboten oder Werbeanzeigen zur Vermeidung sogenannter ‚Dark Patterns‘, beim unzulässigen ‚Profiling‘ Minderjähriger und bei der Überprüfung von Händlern. Dabei wird es darauf ankommen, sich frühzeitig mit den neuen Spielregeln des DSA auseinanderzusetzen, um sich sorgfältig auf diese vorzubereiten.“
Gibt es Erleichterungen für kleine Unternehmen, wie beispielsweise Startups?
Philipp Koehler: „Um kleinere Unternehmen nicht über Gebühr mit der Bewältigung der neuen Anforderungen des DSA zu belasten, enthält der DSA für diese einige Ausnahmen. Dies betrifft zum Beispiel etliche Transparenz- und Berichtspflichten, die Bereitstellung eines Beschwerdemanagementsystems und die Einbeziehung von außergerichtlichen Streitschlichtungsstellen. Ob das zu einer ausreichenden Entlastung führen wird, mag bezweifelt werden.“
Gibt es auch kritische Stimmen? Welche rechtlichen Unsicherheiten gibt es?
Dr. Gregor Schmid: „Angesichts der Fülle an Neuregelungen überrascht es nicht, dass es auch kritische Stimmen gibt. Während dem europäischen Gesetzgeber teilweise Untätigkeit in Bezug auf Digitalisierung und das Internet vorgehalten wurde, sieht man nunmehr das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen. Der DSA verfolgt das ambitionierte Ziel, teilweise sehr unterschiedliche Regelungsbereiche – wie unter anderem Haftung, ‚Point of Contact‘-Regelungen, AGB, Jugendschutz sowie Transparenz- und Berichtspflichten – in einen einheitlichen Rahmen zu spannen. Zugleich bleiben einige Spezialgesetze unberührt, so dass eine Reihe offener Auslegungsfragen zu erwarten sind. Auch wenn im Fokus die sehr großen Online-Plattformen stehen, dürften sich die ‚cost of doing business‘ für die meisten Anbieter digitaler Services spürbar erhöhen.“
Philipp Koehler: „Wie auch bei anderen europäischen Gesetzen verbleiben leider eine Reihe offener Fragen. Wie zum Beispiel bei der DSGVO wird man diesbezüglich etwas Geduld haben müssen, bis diese Fragen durch die Rechtsprechung geklärt werden. Bis dahin sind aber Maßnahmen denkbar, um Risiken vorzubeugen und diese zu minimieren.“
Der DSA sieht umfangreiche Neuregelungen vor, lässt aber zugleich eine Reihe von Spezialgesetzen unberührt, so dass eine Reihe offener Auslegungsfragen zu erwarten sind. Um sorgfältig vorausplanen zu können, sollten Unternehmen zeitnah die Auswirkungen des DSA auf ihre digitalen Aktivitäten hin analysieren.
Related Insights

Der Digital Services Act – ein Überblick
Philipp Koehler und Gregor Schmid beleuchten die wichtigsten Aspekte des neuen EU-Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act)